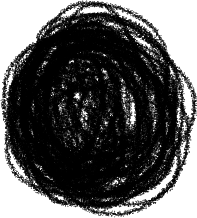Dissens und Macht
Vor 30 Jahren zerfiel die Sowjetunion. Es schien, als würde mit ihr auch die Kontrolle des Staates über die Gesellschaft der Vergangenheit angehören. Doch die Schatten der Vergangenheit treten immer deutlicher zutage. Jahr für Jahr führte der Staat Maßnahmen ein, die allen voran die Versammlungs- und Meinungsfreiheit immer weiter einschränkten. Der großflächige Angriffskrieg in der Ukraine, der am frühen Morgen des 24. Februar 2022 begann, änderte innerhalb von wenigen Tagen das ganze Leben der russischen Zivilgesellschaft: Antikriegsproteste wurden mit Festnahmen auf Rekordenniveau zerschlagen, unabhängige Medien wurden geblockt, aufgelöst oder eingeschüchtert. Es gilt faktisch eine Kriegszensur. Viele oppositionelle Politiker und Aktivisten haben angesichts drohender Haftstrafen das Land verlassen, ihre Arbeit eingestellt.
Vieles erinnert immer mehr an die autoritäre Geschichte der untergegangenen Sowjetunion. Aber diese Geschichte gehört offensichtlich nicht allein der autoritären Macht. Sie gehört genauso den stillen und lauten Akten des Widerstands, eine Erfahrung, die im heutigen Russland wichtiger ist denn je. Wir erzählen, wer die sowjetischen Dissidenten und Andersdenkenden waren, welche Repressionen sie über sich ergehen lassen mussten, und was sie dazu gebracht hat, dennoch diesen Weg zu gehen. Ein Longread.
Prolog
Festnahme, Gefängnis, Gericht, Verurteilung, Strafkolonie … Vor dem Februar 2012 kamen diese Worte Maria Aljochina wie eine fremde Realität vor. Aber dann fiel mit einem Schlag die Mauer, die sie von dieser Welt getrennt hatte: Gemeinsam mit Nadeshda Tolokonnikowa, ihrer Mitstreiterin von Pussy Riot , landete sie hinter Gittern. Ihr provokantes Anti-Putin-Punk-Gebet in der Christus-Erlöser-Kathedrale , dem Symbol des orthodoxen Moskau, wurde zu einem Akt der „Beleidigung religiöser Gefühle“ erklärt. Und Tolokonnikowa und Aljochina zu zwei Jahren Koloniehaft wegen „Rowdytums“ verurteilt.
Wie soll eine junge Frau in dieser gnadenlosen Gefängniswelt überleben, in der sich niemand um die Einhaltung elementarster Rechte schert? Wie Aljochina in einem Interview sagte, begann sie die Antwort auf diese Frage in Büchern zu suchen. In der schonungslosen Prosa Warlam Schalamows las sie von den Schrecken des stalinistischen Gulag . Aber näher an ihrer Realität waren die Erfahrungsberichte derer, die durch Gefängnisse und Lager der spätsowjetischen Zeit gegangen waren: „In den acht Monaten Untersuchungshaft habe ich ständig Memoiren von sowjetischen Dissidenten gelesen, weil ich dachte: Von wem, wenn nicht von ihnen, soll ich lernen? Ich wollte lesen, was andere getan haben, die vor uns dagewesen sind, ich wollte aus ihren Erfahrungen lernen, ich wollte nicht unvorbereitet dort hinfahren. Und dann hast du zum ersten Mal unmittelbar mit diesem System zu tun, einem menschenverachtenden System …“
Besonderen Eindruck machte auf sie Wladimir Bukowski , ein Dissident, der in den 1960er und 1970er Jahren mehrfach zu Gefängnis- und Lagerstrafen verurteilt und in Psychiatrien zwangsbehandelt wurde. „Bukowski liest sich wie ein Lehrbuch“, erinnert sich Aljochina. Von ihm lernte sie unter anderem, wie ein Häftling mit Hilfe von Gesuchen und Beschwerden erreichen kann, dass seine Rechte respektiert werden.
Nach ihrer Freilassung nahm Aljochina mit ihm, der damals in London im Exil lebte, Kontakt auf und bedankte sich für die Lektionen im Überleben, die sie aus seinen Büchern gelernt hatte.
Auch wenn es viele Unterschiede zwischen den Schicksalen Bukowskis und Aljochinas gibt – gemeinsam ist ihnen die Erfahrung, verfolgt zu werden: für das Recht auf freies Denken und Handeln, für das Recht darauf, anders zu sein.
1. „Lebt nicht mit der Lüge“
Am 25. August 1968 lief die junge Dichterin Natalja Gorbanewskaja mit einem Kinderwagen, in dem ein Säugling lag, an den Kremlmauern entlang. Das Stadtzentrum war voller Touristen, und sie hatte Mühe, sich durch die Menge zu zwängen. Nachdem sie das Historische Museum passiert hatte, tat sich der rundum von Polizei umzingelte, „geräumige, fast menschenleere“ Rote Platz vor ihr auf. Am Lobnoje mesto vor der Basilius-Kathedrale traf sie mit Bekannten und Freunden zusammen. Sie waren insgesamt zu siebt. In Gorbanewskajas Kinderwagen, zu Füßen des Babys, lagen versteckt eine tschechoslowakische Flagge und zwei Plakate. Auf dem einem stand in tschechischer Sprache: „Es lebe die freie und unabhängige Tschechoslowakei“, auf dem anderen „Für eure und unsere Freiheit “. Um Punkt 12 Uhr entrollte die Gruppe ihre Plakate und ließ sich zu einer Mahnwache auf den Bürgersteig nieder.
Wenige Tage zuvor waren sowjetische Panzer in Prag eingerollt und hatten dem Prager Frühling ein Ende gemacht. Viele Angehörige der sowjetischen Intelligenzija hatten die Ereignisse in der Tschechoslowakei und das dortige Bestreben, einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ aufzubauen, mit Sympathie, ja sogar mit Begeisterung verfolgt. Sie empfanden den Einmarsch der sowjetischen Truppen als Schlag ins Gesicht des Brudervolkes. Und doch schien niemand den Mut aufzubringen, dagegen zu protestieren.
„Haut die Antisowjetler!“
Gorbanewskaja und ihre Mitdemonstranten wurden sofort von Leuten in Zivilkleidung überwältigt, die vor den Augen einer schaulustigen Menge auf sie einschlugen und ihre Plakate zerrissen. Gorbanewskaja hörte jemanden rufen: „Das sind doch alles Juden!“ und „Haut die Antisowjetler!“. Als jemand sie fragte: „Schämt ihr euch denn gar nicht?“, erwiderte sie: „Doch. Ich schäme mich, dass unsere Panzer in Prag sind.“ Man brachte alle Demonstranten in schwarzen Wolga-Limousinen auf die Polizeiwache. Nur eine Teilnehmerin kam anschließend frei, die anderen erhielten harte Strafen: Einige wurden vom Gericht zu Haft- und Verbannungsstrafen verurteilt; den Philologen Viktor Fajnberg und Natalja Gorbanewskaja erklärte man für psychisch gestört.
Gedanken zu äußern, die von der offiziellen Ideologie abwichen oder Kritik am Regime zu üben, hieß in der Sowjetära, wie unter jeder autoritären Herrschaft, etwas zu riskieren: den Arbeitsplatz, die (relative) Freiheit und manchmal sogar das Leben. Anders zu denken und zu handeln ist in einem autoritären Staat ein seltenes Gut und eine gefährliche Tugend. Die Lebensumstände und eine Reihe von Entscheidungen konnten dazu führen, dass jemand aus der bequemen Lage des gewöhnlichen Sowjetbürgers heraus die riskante ethische Wahl traf, die Alexander Solshenizyn in die Forderung „Lebt nicht mit der Lüge“ gekleidet hat. Anfang der 1970er Jahre appellierte Solshenizyn an die sowjetische Intelligenzija:
„Die Lüge mag alles überzogen haben, die Lüge mag alles beherrschen, doch im kleinsten Bereich werden wir uns dagegen stemmen: OHNE MEIN MITTUN!“
Alexander Solshenizyn, Lebt nicht mit der Lüge1
Eine solche ethische Wahl trafen die Demonstranten am 25. August 1968.
„Jemand, der abseits sitzt“
Im Westen bürgerte sich für Leute wie Gorbanewskaja die Bezeichnung „Dissidenten“ ein. Sie ist vom lateinischen Wort dissidere abgeleitet und bedeutet „jemand, der abseits sitzt“, „Abweichler“. Mit diesem Wort versuchten Beobachter verschiedene Protestbewegungen zu beschreiben, die sich in den 1960er Jahren in der Sowjetunion gebildet hatten. Unter den Dissidenten waren Bürgerrechtler wie Gorbanewskaja oder Andrej Sacharow , die sich für die Menschenrechte und die Freiheit politischer Gefangener einsetzten und zum Gesicht der Bewegung wurden. Doch sie machten nur einen kleinen Teil von ihr aus: Unter den Abweichlern waren auch nationalistische Aktivisten, die für die Unabhängigkeit ihrer Nation oder das Recht auf Emigration eintraten, religiöse Aktivisten, die die Achtung oder Ausweitung religiöser Freiheiten forderten, Kämpfer für soziale und wirtschaftliche Rechte, für Rechte von Menschen mit Behinderungen oder einfach für einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, Feministinnen und viele andere. Bei fast allen, die im Sowjetstaat aufgewachsen waren, begann der Weg in die Dissidenz mit dem Überdenken der bisherigen, von der kommunistischen Ideologie geprägten Ansichten. Den entscheidenden Anstoß dazu gab der XX. Parteitag der KPdSU. Am Ende dieses Parteitags verlas der Erste Sekretär Nikita Chruschtschow seine „Geheimrede“, in dem die Verbrechen Stalins erstmals offiziell anprangert wurden.
Foto: 1980er Jahre / © Nina Alovert, Archiv FSO
2. Umdenken
1956 war Roi Medwedew Direktor einer Dorfschule in der Oblast Leningrad. Ende März wurde die gesamte Belegschaft der Schule in einen nahe gelegenen Betrieb bestellt. Im Festsaal saßen Ingenieure und Arbeiter, die sich erstaunt umblickten. Keiner von ihnen wusste, warum sie hier versammelt wurden. Dann ergriff der Instrukteur vom Parteibezirkskomitee das Wort. Als Erstes stellte er klar, es werde keine Debatte geben. Dann las er langsam den Vortrag Über den Personenkult und seine Folgen vor, den Chruschtschow einen Monat zuvor auf dem XX. Parteitag gehalten hatte. Der Reihe nach zählte er die Verbrechen Stalins auf, der nur drei Jahre zuvor noch einen fast gottgleichen Status gehabt hatte. Vier Stunden lang saßen alle im Saal mit angehaltenem Atem und entsetzten Gesichtern da. Dann ging man schweigend auseinander.
Hoffnung auf Gerechtigkeit und Gleichheit
Die Oktoberrevolution hatte sehr unterschiedliche Emotionen hervorgerufen – von Ablehnung und dem Willen, mit der Waffe in der Hand gegen die Bolschewiki zu kämpfen, bis zu Begeisterung und enthusiastischer Befürwortung. Viele verbanden mit ihr die Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Gleichheit, ohne zu bedenken, dass die Idee des Kommunismus von Anfang an eine Utopie war. Denn Bolschewiki dachten, sie könnten mit der eisernen Hand der Partei die Wirtschaft von Grund auf reformieren und einen „neuen Menschen“ schmieden – den Homo Sovieticus . In den 1930er Jahren erzwang Stalin die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Modernisierung des Landes. Beides erforderte riesige Menschenopfer. Um diese Ziele zu erreichen, wurden nicht nur die wichtigsten materiellen Ressourcen des Landes mobilisiert, sondern auch gewaltige Humanressourcen, unter anderem Gulag-Häftlinge. Ihren Höhepunkt erreichte die staatliche Gewalt mit den Massenrepressionen von 1937/38 , denen nicht nur aktive Gegner des Sowjetregimes zum Opfer fielen, sondern auch zahlreiche Parteimitglieder. Dennoch blieben viele Menschen, die an der Revolution und am Bürgerkrieg teilgenommen hatten, den Ideen des Sozialismus treu, selbst nach langjähriger Verbannung und Lagerhaft. Die Generation, die nach der Revolution geboren wurde, war mit sozialistischen Idealen aufgewachsen, und es wäre eine grobe Vereinfachung, sie ausschließlich auf den Personenkult um Stalin zu reduzieren.
Die von Chruschtschow eingeleitete Entstalinisierung war eine politische Notwendigkeit, zugleich aber auch politisch riskant. Chruschtschow glaubte, es werde die moralische Autorität der Partei erhöhen, wenn die Parteiführung selbst die Verbrechen der Vergangenheit enthüllte. Bald zeigte sich jedoch, dass er eine Büchse der Pandora geöffnet hatte, die ohne Repressionen nicht wieder zu schließen war. Auf Wellen relativer Liberalisierung folgten Phasen, in denen „die Daumenschrauben angezogen wurden”. Doch insgesamt konnte die sowjetische Gesellschaft in der Ära, die den poetischen Namen „Tauwetter “ erhielt, neuen Atem schöpfen: Es wurden literarische Werke gedruckt, die sich bislang tabuisierten Aspekten der stalinistischen Vergangenheit widmeten und es kamen ausländische Besucher ins Land.
Sohn eines „Volksfeindes“
Roi Medwedew war der Sohn eines „Volksfeindes“, der 1941 in einem Lager umgekommen war. Aus einem Brief, den sein Vater heimlich aus dem Lager geschickt hatte, wusste Medwedew bereits damals, dass Häftlinge gefoltert wurden. Er wusste auch von den Schrecken des Lagerlebens – ein Freund des Vaters, der zusammen mit diesem in Kolyma gewesen war, hatte ihm davon erzählt. Aber das wahre Ausmaß des Terrors hatte Roi Medwedew so wenig erahnt wie die meisten Sowjetbürger.
„Ich habe an die Unschuld meines Vaters geglaubt, aber zugleich auch an Stalins Unschuld. Ich dachte, er sei getäuscht worden. Der XX. Parteitag hat das Vertrauen in Stalin zerstört, das ich bis dahin hatte.“
Roi Medwedew, Erinnerungen
Medwedew gehörte zur Generation der Schestidesjatniki (dt. „Sechziger“). Ihre Väter hatten sich aktiv am Aufbau der Sowjetmacht beteiligt, sie selbst waren unter Stalin aufgewachsen. Roi und sein Bruder Shores hatten gemeinsam mit ihren Altersgenossen im Großen Vaterländischen Krieg die sowjetische Heimat verteidigt. Es fiel ihnen nicht leicht, ihre Ansichten zu ändern. Auch wenn die Ideale ihrer Jugend auf dem XX. Parteitag zerstört wurden, glaubten viele weiter an die Möglichkeit eines demokratischen Sozialismus. Als Medwedews Vater bald darauf rehabilitiert wurde, trat Roi in die KPdSU ein: Er sah die Partei auf dem Weg der Erneuerung und Demokratisierung und wollte sich an diesem Prozess beteiligen. 1962 begann er mit der Arbeit an einer Studie über die Geschichte des Stalinismus, die er in der Sowjetunion publizieren wollte.
Das Urteil der Geschichte
Doch dann änderte sich schlagartig die politische Situation: Im Oktober 1964 wurde Chruschtschow entmachtet, und Leonid Breshnew trat an die Spitze der Partei. Die neue Führung setzte der Entstalinisierungspolitik bald ein Ende. Medwedews Geschichte des Stalinismus war noch nicht erschienen, aber man wusste in Parteikreisen um ihre Existenz und sie wurde für antisowjetisch erklärt. Medwedew hielt sein Werk berechtigterweise für konform mit der Linie des XX. Parteitags. Dennoch wurde er 1969 aus der Partei ausgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Manuskript bereits ins Ausland geschickt, wo es zwei Jahre später unter dem Titel Das Urteil der Geschichte: Stalin und Stalinismus veröffentlicht wurde und den Autor berühmt machte. Dies ermöglichte ihm, trotz wiederholter Durchsuchungen und Einschüchterungsversuche, ein „freier Wissenschaftler“ zu bleiben und seine Texte im Westen zu publizieren.
Als im August 1968 sowjetische Panzer in Prag einfuhren, zerschlugen sich die letzten Hoffnungen der sowjetischen Intelligenzija auf eine Demokratisierung des Regimes. Die Demonstration der sieben Dissidenten am 25. August auf dem Roten Platz hatte viele heimliche Unterstützer. Aber nur wenige Menschen waren bereit, sich für ihre politischen Ansichten aufzuopfern. Offener Widerstand – oder auch nur symbolischer, in Form eines Parteiaustritts – war eine schwerwiegende Lebensentscheidung. Viel leichter war es, äußerlich Konformität zu wahren, gehorsam die Prawda zu abonnieren und heimlich verbotene Literatur zu lesen.
Für die sowjetischen Nachkriegsgenerationen war die kommunistische Ideologie bereits weitgehend eine tote Hülle, eine Ansammlung obligatorischer, aber sinnloser Rituale und der vertraute graue Hintergrund des Alltags. Niemand hegte die Illusion, das Sowjetregime könne plötzlich zusammenbrechen – damals schien es von ewiger Dauer zu sein. Umso wichtiger war es, sich inoffizielle Freiräume zu schaffen und mit Sinn zu füllen, sei es nun Rock’n’Roll, Buddhismus oder ein religionsphilosophischer Zirkel.
Foto: 1973 © Margarita Medwedewa
3. Inseln der Freiheit
Leningrad, Anfang der 1970er Jahre. Ein junger Hippie spaziert durch die Stadt und sieht einen Typen in Jeans, mit Bart und schulterlangen Haaren. Er steuert direkt auf ihn zu und fragt:
„Sind Sie ein Antisowjetler?“
„Ja.“
„Kann ich bei Ihnen übernachten?“
So begann die Freundschaft von Alexander Ogorodnikow und Wladimir Poresch. Der Begriff „Antisowjetler“, im offiziellen Sprachgebrauch ein Schimpfwort, war in den letzten Jahrzehnten der Sowjetunion für ganze Subkulturen zu einer Auszeichnung geworden. Das äußere Erscheinungsbild spiegelte die Distanz zur kommunistischen Ideologie wider. Das galt vor allem für Jeans – für die offizielle Propaganda ein Symbol der „Verneigung vor dem Westen“, aber heißbegehrt auf dem Schwarzmarkt, wohin sie aus Europa oder den USA gelangte.
Vorbildlicher Komsomolze
Nur wenige Jahre zuvor war Ogorodnikow noch ein vorbildlicher Komsomolze gewesen. Mit 15 hatte er einen Trupp zusammengestellt, um gegen Rowdybanden vorzugehen und an Ostern mit seinen Mitstreitern eine Kathedrale besetzt, um junge Menschen vom Gottesdienst fernzuhalten. Zudem hatte er sich gegen Alkoholkonsum und lange Haare engagiert. Vor ihm lag eine glänzende Karriere im Komsomol. Aber die selbstständige Lektüre von Lenins Werken ließ ihn an der Menschlichkeit der kommunistischen Ideologie zweifeln, und nur einen Monat nach Aufnahme seines Philosophiestudiums wurde er wegen „einer Denkweise, die mit der Bezeichnung sowjetischer Student unvereinbar [war]“, exmatrikuliert.
Wie viele seiner Altersgenossen sehnte sich Ogorodnikow nach Freiheit und suchte nach dem Sinn des Lebens. In der Moskauer Hippieszene fand er die passende Subkultur, eine kleine Insel der Freiheit im autoritären Ozean der Sowjetunion. Nicht anders als im Westen hatten auch die Hippies in der UdSSR einen Hang zur Spiritualität, die ihrer Rebellion gegen die Gesellschaft einen tieferen Sinn verlieh. Als Ogorodnikow das Christentum für sich entdeckte, gab das seiner spirituellen Suche eine neue Richtung. 1973 initiierte er die Gründung eines christlichen Seminars, das sich mit „Fragen der religiösen Erneuerung“ beschäftigte. Die Mitglieder trafen sich in einem Haus in der Provinz, das Ogorodnikow von den Spenden der Adepten gekauft hatte. Auch in anderen sowjetischen Städten bildeten sich ähnliche Gruppen, die Ogorodnikows Seminarhaus bis zu seiner Verhaftung wegen „Schmarotzertum“ im Jahr 1978 regelmäßig besuchten.
Abstufungen und Formen des Nonkonformismus
Zwischen dem einfachen, stillen Dissens und dem aktiven Widerstand gegen das Regime gab es viele Abstufungen und Formen des Nonkonformismus. Die meisten Andersdenkenden befolgten nach außen hin die herrschenden Verhaltensnormen: Ihre Kinder waren Pioniere und Mitglieder in Jugendorganisationen, sie selbst gingen wählen und stimmten für den einzigen Kandidaten, manche traten aus Berufsgründen auch in die Partei ein. Aber das alles hinderte sie nicht daran, verbotene Samisdat -Literatur zu lesen oder ihre Kinder taufen zu lassen. Fast alles davon geschah im Geheimen. Nach und nach hatten die Sowjetmenschen gelernt, das eine zu denken, etwas anderes zu sagen und etwas Drittes zu tun.
Der Anthropologe Alexei Yurchak , der eine Studie über Die letzte Sowjetgeneration verfasst hat, hebt die Fähigkeit dieser Generation hervor, gleichzeitig inner- und außerhalb des offiziellen Systems zu sein – je nach Umständen. Man musste nicht zwangsläufig mit dem System brechen und offenkundig zum Dissidenten werden, viel einfacher war es auf der Suche nach Freiheit regelmäßig in den Underground „abzutauchen“.
Neben der Hippiekreisen und den christlichen Gruppen und Seminaren gab es in der Sowjetunion noch eine Reihe weiterer „systemferner“ alternativer Szenen: Anhänger der Rockmusik hatten eine eigene Subkultur mit Konzerten im Untergrund und „Magnitizdat“ – inoffiziell vertriebenen Tonbandaufnahmen. Avantgardistische Künstler veranstalteten Wohnungsausstellungen, bei denen Arbeiten gezeigt wurden, die der Regierung missfielen.
Die parallele Polis
Die Form dieser Zusammenkünfte orientierte sich an der Kultur der Amateurzirkel und Küchengespräche, die sich in der Sowjetunion etabliert hatte und der Intelligenzija vertraut war. Obwohl inoffizielle Vereinigungen gesetzlich verboten waren, gingen aus den regelmäßigen Debatten am Küchentisch oft feste Gruppen hervor, die sich mit bestimmten Themen befassten – von Philosophie bis Esoterik, von Poesie bis Politik. Manche dieser Gruppen publizierten sogar eigene (illigale) Zeitschriften.
Das war allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der Sowjetunion – die Undergroundkultur war in ganz Osteuropa sehr verbreitet. Der tschechoslowakische Philosoph Václav Benda nannte sie „die parallele Polis“ (abgeleitet von griech. polis: Verband der freien Bürger). Im Untergrund entstanden Druckereien, Schulen und Seminare. Es bildete sich gewissermaßen eine Parallelgesellschaft.
Die Hauptfunktion der parallelen Polis war in allen damaligen sozialistischen Ländern die Verbreitung von politischer Information, Literatur und Protestbriefen – des Samisdat , und später des Tamisdat .
Foto: 1978 © Archiv FSO
4. Samisdat und Tamisdat
Im November 1962 spazierte Warlam Schalamow, Autor der damals noch unveröffentlichten Erzählungen aus Kolyma über das Leben auf einer der grausamsten Insel des Archipel Gulag, durch das Stadtzentrum von Moskau. Er erreichte den Puschkinplatz, setzte sich auf eine Bank und schlug eine Ausgabe der beliebten Zeitschrift Nowy Mir auf, die er irgendwo ergattert hatte. Es dauerte nicht lange, bis mehrere Menschen auf ihn zukamen und wissen wollten, ob das das Heft Nummer 11 sei.
„Ja, Nr. 11!“
„Die mit der Lager-Novelle?“
„Ja, genau!“
„Wo haben Sie die her, wo haben Sie sie gekauft?“
„Literarisches Wunder“
Bei der Lager-Novelle handelte es sich um die Erzählung Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch aus der Feder des damals noch völlig unbekannten Alexander Solschenizyn . Der Protagonist Iwan Schuchow war ein einfacher politischer Häftling eines durchschnittlichen Lagers, der dort zehn Jahre wegen „Spionage“ zu verbüßen hatte. Die Publikation der Novelle bedeutete das Ende des langjährigen Tabus, literarische Texte über die stalinistischen Repressionen zu veröffentlichen. Dass die Erzählung überhaupt gedruckt werden konnte, war dank der persönlichen Erlaubnis Chruschtschows möglich geworden, der ein Jahr zuvor, anlässlich des XXII. Parteitags der KPdSU, zu einem erneuten Angriff gegen Stalin ausgeholt hatte. Der bekannte Schriftsteller Kornej Tschukowski bezeichnete die Publikation als „literarisches Wunder“.
Unter dem Eindruck von Iwan Denissowitsch schrieb Warlam Schalamow einen Brief an Solschenizyn:
„Erlauben Sie mir, Ihnen, mir selbst sowie den Tausenden von Überlebenden und Hunderttausenden (wenn nicht Millionen) von Opfern zu gratulieren, denn auch sie leben fort in dieser wahrhaft bemerkenswerten Erzählung …“
Warlam Schalamow, Brief an Solschenizyn, 1962
1962 war es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, an die 11. Ausgabe der Nowy Mir zu kommen, in den Bibliotheken ließen sich die Leute auf monatelange Wartelisten setzen. Aber noch vor der Veröffentlichung kursierte das Manuskript in schreibmaschinengeschriebenen Kopien. In parodistischer Anlehnung an die Abbreviaturen der Namen staatlicher Verlage wie Politisdat oder Lenisdat bekam diese Methode der privaten und oft konspirativen Vervielfältigung und Verbreitung von Literatur den Namen „Samisdat “. Die Druckerpresse ersetzen Schreibmaschine und Durchschlagpapier – so ließen sich bis zu sechs Kopien auf einmal produzieren, auch wenn die letzte oft kaum noch lesbar war. Man erstellte Kopien für den Eigengebrauch und für Freunde, populäre Texte wurden auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Im Samisdat erschienen vor allem kürzere literarische, philosophische oder politische Texte, die es nicht durch die Zensur geschafft hatten, seltener auch umfangreichere Werke sowjetischer, ausländischer und im Exil lebender Autoren.
Die Veröffentlichung von Iwan Denissowitsch machte Solschenizyn auf einen Schlag berühmt. Doch mit dem Abtritt von Chruschtschow verlor er seinen Protegé in der Partei und wurde mit der Zeit zum Dissidenten Nr. 1. Als er seinen Roman Krebsstation nicht in der UdSSR veröffentlichen durfte, beschloss Solschenizyn, ihn über den Samisdat zu verbreiten. Um den Mechanismus in Gang zu setzen, musste er lediglich ein paar Kopien mit der Schreibmaschine anfertigen und sie an potentielle Leser weitergeben. Danach konnte sich das Werk ohne das Zutun des Autors weiter vermehren.
Frischer Atemzug in einem stickigen Raum
Für die Menschen in der UdSSR kam die Lektüre des Samisdat einem frischen Atemzug in einem stickigen geschlossenen Raum gleich. Die Leser gingen nicht geringe Risiken ein, um für eine oder zwei Nächte ein verbotenes Buch zu ergattern; sie kauften die Exemplare auf dem Schwarzmarkt oder bei befreundeten Stenotypisten. Später gab es auch Fotokopien der im Untergrund verbreiteten Texte und Bücher. Wenn bei einer Durchsuchung ein Samisdat, insbesondere ein Werk von Solschenizyn oder anderer „aufwieglerischer“ Autoren gefunden wurde, konnte das schwere Konsequenzen nach sich ziehen: den Verlust des Arbeitsplatzes oder sogar Arrest. Nichtsdestotrotz war die Samisdat-Lektüre eine weit verbreitete Praxis, bis sie, zumindest in den großen Städten, vom „Tamisdat “ verdrängt wurde: Bücher sowjetischer Autoren, die im Westen veröffentlicht wurden.
In den Westen gelangten die Originalmanuskripte oder Kopien der Autoren mit deren Wissen oder auch ohne. Die Dissidenten übermittelten ihre Texte über ausländische Journalisten, die Diplomatenpost oder gelegentlich reisende Touristen und Studenten. Im Westen wurden Verlage gegründet, die sich auf Werke aus der Sowjetunion spezialisierten. Für sowjetische Autoren bedeutet es allerdings auch ein Risiko, im Westen veröffentlicht zu werden: In der Regel wurde damit jede Möglichkeit ausgeschlossen, jemals in der Heimat zu erscheinen. Wenn die Werke eines Autors beispielsweise bei „Possew“ erschienen, dem Verlag der antikommunistischen „Volksarbeitsbundes der russischen Solidaristen“ (NTS), dann konnte man ihn der Verbindung zu einer antisowjetischen Organisation bezichtigen. Der Autor konnte zwar versuchen, seine Identität hinter einem Pseudonym zu verstecken, aber vor Repressionen konnte einen in der Regel nur ein hoher Bekanntheitsgrad im Westen beschützen.
1970 erhielt Solschenizyn für seine im Westen veröffentlichten Romane Krebsstation und Im ersten Kreis den Nobelpreis für Literatur. Zur Preisverleihung fuhr er nicht – im Wissen, dass eine Reise nach Stockholm für ihn die Zwangsemigration bedeuten würde. Aber dass die Sache kein gutes Ende nehmen würde, spürte er schon damals.
Das „Solschenizyn-Problem“
Zu diesem Zeitpunkt war das Manuskript von Archipel Gulag, das dem Regime den symbolischen vernichtenden Schlag versetzen sollte, bereits als Mikrofilm nach Paris gelangt. Es handelte sich um eine literarische Erforschung der Geschichte des Lagersystems in drei Bänden, die Solschenizyn auf der Grundlage von Briefen ehemaliger Häftlinge verfasst hatte, die ihn nach dem Erscheinen von Iwan Denissowitsch erreichten. Solschenizyn beeilte sich nicht mit der Veröffentlichung, denn er wollte sich ein paar Jahre ungestörter Arbeit an Das rote Rad sichern, einem mehrbändigen Werk über die Geschichte der russischen Revolution. Doch das Drama um seine Stenotypistin, die im August 1973 auf Druck des KGB hin das Versteck des Manuskripts preisgab und sich daraufhin das Leben nahm, zwang ihn dazu, seinen Plan zu ändern und das Buch umgehend zu veröffentlichen. Am 28. Dezember 1973 erschien Archipel Gulag in Paris.
Die sowjetischen Behörden suchten lange nach einem Weg, wie man das „Solschenizyn-Problem“ lösen könnte, ohne die allmähliche Entspannung der Beziehungen zum Westen zu gefährden. Doch die Veröffentlichung einer so umfassenden literarischen Erforschung des Gulag konnte für den Autor nicht ohne Folgen bleiben. Nach einer Hetzjagd in der sowjetischen Presse wurde Solschenizyn verhaftet und in ein Flugzeug nach Frankfurt am Main gesetzt. Es schien der Parteiführung eine unverfänglichere Lösung, dem Nobelpreisträger die sowjetische Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihn in die Verbannung zu schicken, als ihn in ein Lager für politische Häftlinge zu stecken.
Den Lesern von Solschenizyn und anderen Samisdat-Autoren drohten in der Sowjetunion schwere Konsequenzen. So wurde 1972 der Physiker Kronid Ljubarski aus Noginsk in der Nähe von Moskau wegen der Verbreitung von Samisdat zu fünf Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. In seinem Schlussplädoyer sprach Ljubarski über die Motive, die ihn dazu bewegt hatten, zum Samisdat zu greifen:
„Informationen sind für einen Wissenschaftler sein täglich Brot. So wie der Bauer mit Erde arbeitet, der Arbeiter mit Metall, so arbeitet der Intellektuelle mit Informationen. Nur wer über Informationen verfügt, kann sich eine unabhängige Meinung bilden. […] Ich würde gerne in den Zeitungen von politischen Gerichtsverhandlungen lesen, aber dieses Material existiert nicht in den Zeitungen – also greife ich zur Chronik [der laufenden Ereignisse]. Was können Sie mir denn stattdessen empfehlen?“
Der Fall Ljubarski und Popow, Chronik der laufenden Ereignisse Nr. 28, 1972
Das Lesen von Samisdat wurde selbst nicht als Protest gewertet, dennoch versuchten die meisten die Lektüre geheimzuhalten. Über den Samisdat wurden allerdings häufig Protestbriefe an die sowjetische Regierung verbreitet – sie waren die ersten Vorboten der Dissidentenbewegung, innerhalb deren sich eine ganze Reihe von Protestpraktiken entwickelte, von Demonstrationen bis hin zu Appellen an die Weltöffentlichkeit.
Foto: 1962 © Alexander Less, Sputnik
5. Dissidentische Praktiken
„Ljudmila Michajlowna, erzählen Sie bitte: Womit beschäftigen Sie sich die letzten drei Jahre//haben sie die letzten drei Jahre gemacht?“
„Ich arbeite als Redakteurin im Verlag Nauka (dt „Wissenschaft”).“
„Und was machen Sie neben der Arbeit?“
„Ich kümmere mich um meine Kinder.“
„Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Briefe unterschrieben?“
„Was meinen Sie?“
„Beispielsweise einen Brief an den Generalstaatsanwalt.“
Seit Mitte der 1960er Jahre waren kollektive Briefe ein verbreitetes Mittel, als Bürger seine Besorgnis über bestimmte Fragen zu äußern. 1967 unterschrieb Ljudmila Alexejewa ihren ersten Protestbrief, nämlich zur Unterstützung der Dissidenten Juri Galanskow, Alexander Ginsburg, Alexej Dobrowolski und Vera Laschkowa. Nicht nur den Teilnehmern an Demonstrationen und jenen, die Materialien des Samisdat weitergaben – auch den Unterzeichnern solcher Briefe drohten Konsequenten, in erster Linie der Ausschluss aus der Partei oder der Verlust des Arbeitsplatzes. Am verwundbarsten waren Frauen, insbesondere alleinerziehende Mütter, die es sich nicht erlauben konnten, ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Ljudmila Alexejewa war lange Zeit mit bekannten Dissidenten befreundet gewesen und hatte ihnen mehrfach geholfen. Sie hatte gehofft, dass die Behörden davon nichts erfahren würden. Daher hatte sie nicht sofort den Mut, ihren ersten Protestbrief zu unterschreiben. Für sie hätte das bedeutet, offen gegen das Regime aufzutreten, im eigenen Namen: “Wenn ich unterschreibe, was wird dann aus mir, aus meinen Söhnen? Was ist mit der Arbeit? Was mache ich, wenn ich die verliere?“
„Hast du schon unterschrieben?“
Sie beruhigte sich mit dem Gedanken, dass sie immer noch in der Textilfabrik arbeiten könne, wenn sie aus der Redaktion entlassen würde. Das Gehalt wäre zwar geringer, aber sie könnte trotzdem irgendwie davon leben … Ihr jüngster Sohn drängte sie, ihrem Gewissen zu folgen: „Alle unterschreiben diese Briefe, auch deine Freunde. Hast du schon unterschrieben?“ Wie konnte sie ihre Kinder zu ehrlichen, mutigen Menschen erziehen, wenn sie ihre eigenen Überzeugungen verriet? Schließlich unterschrieb sie. Bald darauf wurde sie in das Bezirkskomitee der Partei vorgeladen, in der sie 16 Jahre lang Mitglied gewesen war. Alexejewa hatte den Brief mit der allgemeinen Formulierung „L. Alexejewa, Redakteurin“ unterschrieben und hätte sich leicht mit der Lüge herausreden können, dass es gar nicht sie gewesen war. Ihrem Gewissen zu folgen, bedeutete jedoch, bis zum Ende ehrlich und entschlossen zu sein:
„Ja, ich habe unterschrieben.“
„Warum haben Sie diesen Brief unterschrieben?“
„Ich bin mit allem einverstanden, was in dem Brief gesagt wird, deshalb habe ich unterschrieben.“
Daraufhin wurde sie aus der Partei ausgeschlossen und verlor ihre Stelle.
Dialog mit der Regierung
Den Brief zu unterschreiben, war für sie nicht nur eine Frage des Gewissens, es geschah auch aus der Hoffnung heraus, mit der Regierung in einen Dialog treten zu können:
„Unser Wunsch, der Regierung zu sagen, was wir denken, war nicht einfach ein Gefühlsausbruch. Uns war bewusst, dass tatsächliche Veränderungen ohne Beteiligung der Regierung nicht möglich sein würden. Sie hielt die politische Macht in ihren Händen. Wir hatten nicht die Absicht, ihren Platz einzunehmen. Wir hatten nicht vor, zu den Waffen zu greifen und Untergrundzellen zu bilden. Wir riefen die Regierung zu einem Dialog auf. Um einen Dialog zu beginnen, muss man sich dem anderen zu erkennen geben und sagen, wer wir sind und was wir wollen.“
Ljudmila Alexejewa, Pol Goldberg: Pokolenije ottepeli, 2006
Die verstärkten Repressionen gegen Dissidenten machten allerdings deutlich, dass das Streben nach einem Dialog sinnlos war. Wenn Mitte der 1960er Jahre noch einzelne Vorstöße der sowjetischen Intelligenzija, etwa gegen eine Rehabilitierung Stalins, eine gewisse Wirkung hatten, so schwand der Einfluss der Dissidenten auf das Regime nach 1968 fast völlig. Gleichzeitig stieg angesichts der internationalen Entspannung der Einfluss westlicher Politiker auf die sowjetische Führung. Alexejewa, Sacharow und andere Bürgerrechtler wandten sich nun immer häufiger an die Weltöffentlichkeit und mitunter auch an konkrete westliche Politiker oder gesellschaftliche Organisationen – von den Vereinten Nationen bis zum Weltkirchenrat. Alexejewa beteiligte sich an der Gründung der Moskauer Helsinki-Gruppe , die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Einhaltung der Schlussakte von Helsinki in Bezug auf die Menschenrechte zu überwachen. Ein Jahr später musste Alexejewa hierfür mit der Emigration bezahlen, weil ihr sonst eine Verhaftung gedroht hätte.
Die Dissidenten, die noch rechtzeitig emigriert waren – sei es aus freien Stücken oder unter Zwang –, führten ihre Aktivitäten oft auch jenseits des Eisernen Vorhangs fort. Alexejewa arbeitete, wie so viele von ihnen, bei Radio Swoboda, das in der jeweiligen (Landes)sprache in die Länder des Ostblocks sendete. Auf Anregung der US-Administration unter Präsident Carter schrieb sie die erste Monographie über die Geschichte der sowjetischen Dissidentenbewegung. Andere Dissidenten veröffentlichten ihre Texte in den Zeitschriften und Zeitungen der russischen Diaspora. Ein wichtiges Ziel dieser Publikationen bestand darin, die Aufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit auf das Schicksal jener zu richten, die in der UdSSR verblieben und Repressionen ausgesetzt waren – besonders jener Dissidenten, die eine Gefängnisstrafe verbüßten, im Besserungslager saßen oder in die Verbannung geschickt worden waren.
Foto: vor der Emigration, ca. 1977 © Archiv Memorial
6. Repressionen
„Arseni Borissowitsch, Sie haben zehn Tage zum Nachdenken. Zehn Tage. Sie verstehen das alles …“ Im April 1981 wurde der junge Historiker Arseni Roginski ins OWIR vorgeladen, eine Abteilung der sowjetischen Innenverwaltung, die für Migrationsfragen zuständig war, und ihm wurde dort eine Einladung eines nicht existierenden Verwandten zur Ausreise nach Israel vorgelegt. Eine erzwungene Emigration erschien der sowjetischen Führung humaner als eine Verhaftung oder eine Gefangenschaft im Lager. Gleichzeitig war das für die sowjetische Propaganda ein sehr einfacher Weg, unbequeme Bürger loszuwerden. In Wirklichkeit aber war es für viele eine nicht weniger grausame Bestrafung als eine Gefängnishaft: Wer emigrierte, verabschiedete sich für immer von seiner Heimat und verlor für immer seine Hoffnung, Angehörige und Freunde, die in der UdSSR blieben, jemals wiederzusehen.
Arseni Roginski wusste sehr wohl, dass man ihn nach diesen zehn Tagen umgehend verhaften würde.
„Einerseits wusste ich ganz bestimmt, dass ich nicht ausreisen will, dass ich nicht auswandern werde … Und andererseits habe ich mich mit aller Energie vorbereitet – auf die Verhaftung oder auf die Ausreise, ich weiß es selbst nicht. Wohl eher auf die Verhaftung … Ich hatte keine Zweifel; der Gedanke an eine Ausreise war mir widerwärtig, fast schon physisch, weil es nicht mein Gedanke war.”
Arseni Roginski im Interview
Er lehnte die „Einladung” ab.
Dem KGB war natürlich bekannt, dass ein inoffizielles Redaktionsteam unter dem jungen Historiker einen historischen Sammelband mit dem Titel Pamjat (dt. „Erinnerung“) herausgegeben hatte. Nach dem Erscheinen der zweiten Ausgabe 1977 wurden die Redakteure beschattet und überwacht, ihre Wohnungen wurden mehrfach durchsucht, Unterlagen wurden konfisziert und sie wurden zu Verhören vorgeladen. Einige von ihnen verloren ihre Arbeit.
„Prophylaktische“ Maßnahmen
Das Vorgehen des KGB – von der Überwachung über die Durchsuchungen und Verhöre bis zum Ausschluss aus der Universität und den Entlassungen – hatten nur ein Ziel, nämlich den jungen Menschen Angst einzujagen und sie dazu zu zwingen, von ihrer „antisowjetischen Betätigung“ abzulassen. Diese „prophylaktischen“ Maßnahmen waren weniger als Repressionen ersonnen worden, denn als „Warnungen“, dass ihr Handeln Folgen haben könnte. In vielen Fällen war eine Einschüchterung bereits ausreichend: Längst nicht alle waren bereit, wegen Mitarbeit an einer Geschichts- oder Literaturzeitschrift ins Gefängnis zu gehen.
Wer seine Betätigung nicht aufgab, den erwarteten härtere Strafen. Es gab Dissidenten, etwa Roginski, denen die Emigration „angeboten“ wurde, vor allem, wenn sie im Westen bekannt waren. Mit den weniger bekannten Dissidenten, besonders in den nichtrussischen Unionsrepubliken, rechnete man schlichter und härter ab. Zur Bestrafung der „Antisowjetischen“ gab es im Strafgesetzbuch der UdSSR zwei geeignete politische Paragraphen. Um aber die Zahl der offiziellen politischen Gefangenen zu drücken, wurden gegen Dissidenten oft auch „normale“ Strafparagraphen eingesetzt. So konnten Dissidenten des Landfriedensbruchs, der Vergewaltigung oder anderer, oft wenig wahrscheinlicher, Straftaten beschuldigt werden.
Als Arseni Roginski sich geweigert hatte zu emigrieren, beschuldigte man ihn der Urkundenenfälschung, um sich Zugang zu Archiven zu verschaffen. Im Dezember 1981 wurde er zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Er kam im August 1985 wieder frei.
Freiheitsstrafe, Psychiatrie oder Emigration
In jedem Dissidentenzirkel konnte sich ein Spitzel eingeschlichen haben, ein Informant der Staatssicherheitsbehörden, der gleichzeitig ein enger Freund und ein aktives Mitglied der Gruppe sein konnte. Eine solche Durchdringung erlaubte es dem KGB zu verfolgen was dort vor sich ging und Material zur Verfolgung zu sammeln. Am häufigsten warb der KGB Informanten im Umfeld oder unter Angehörigen bekannter Dissidenten an, oder aber innerhalb bestehender Dissidentengruppen. Der Rekrutierung ging gewöhnlich Druck voraus: Den potenziellen Informanten wurde mit Entlassung, Verhaftung oder einem Vorgehen gegen die Familie gedroht, wenn sie sich weigern zusammenzuarbeiten. In den Erinnerungen von Dissidenten wird oft von Anwerbungsversuchen berichtet.
Viele Dissidenten erklärten sich nach der Verhaftung – als Gegenleistung für eine mildere Strafe – zu einem Geständnis bereit oder sogar zur Preisgabe von Mitstreitern. Mitunter wurden Geständnisse von reuigen Stellungnahmen im sowjetischen Fernsehen begleitet, wie etwa 1973 im Fall von Pjotr Jakir und Viktor Krassin; die Beschuldigten belasteten dabei sich und andere. Die Auftritte hatten eine zutiefst demoralisierende Wirkung auf alle Andersdenkenden, die noch in Freiheit waren.
Eine weitere Methode, mit den Dissidenten abzurechnen und gleichzeitig die Bewegung zu diskreditieren, war die Zwangsbehandlung in einer Psychiatrie. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Diagnose erfunden: schleichende Schizophrenie. Diese konnte angeblich unbemerkt bleiben und dabei eine große Gefahr für die Gesellschaft bedeuten. Opfer der Strafpsychiatrie waren u. a. die bekannten Dissidenten Wladimir Bukowski und Leonid Pljuschtsch, die später nach ihrer Emigration diesen medizinischen Missbrauch in der UdSSR publik machten.
Mehr Glück hatte der Biologe Shores Medwedew. 1970 versuchte man ihn wegen seiner für das Sowjetregime unbequemen Bücher in die Psychiatrie von Kaluga einzuweisen. Er war allerdings bereits ein im Westen bekannter Wissenschaftler, und es gelang ihm, eine breite Protestkampagne zu starten, die letztendlich zu seiner Freilassung führte.
Foto: 1980 © Archiv FSO
7. Ausländische Agenten
„Sie werden also angeklagt … oder bislang noch verdächtigt, aber es wird bald Anklage gegen Sie erhoben werden … wegen Verrats am Vaterland in Form von Unterstützung kapitalistischer Staaten bei der Durchführung feindlicher Aktivitäten gegen die UdSSR …”
Natan (Anatoli) Schtscharanski war ein sowjetisch-jüdischer Ingenieur und Mathematiker, der 1973 einen Antrag auf Ausreise nach Israel stellte, worauf er einen otkas (dt. „Absage”) erhielt. Von diesem Zeitpunkt an beteiligte er sich an Bürgerrechtsaktivitäten der sogenannten Otkasniki . Später gründete er zusammen mit anderen die Moskauer Helsinki-Gruppe. Ein wichtiger Teil seiner Aktivitäten bestand in der Pflege von Kontakten zu westlichen Journalisten, denen er Informationen über Menschenrechtsverletzungen zukommen ließ, damit sie im Westen publik gemacht wurden.
„Vaterlandsverräter“
Im März 1977 erschien in der sowjetischen Tageszeitung Iswestija ein Artikel, in dem Schtscharanski und andere Aktivisten der Spionage gegen die UdSSR und der Arbeit für den CIA beschuldigt wurden. Elf Tage später wurde er unter dem Verdacht des „Verrats am Vaterland“ und der „Unterstützung eines ausländischen Staates bei der Durchführung feindlicher Aktivitäten gegen die UdSSR“ verhaftet.
„Ich habe keinerlei Verbrechen begangen. Meine gesellschaftliche Tätigkeit als Aktivist der jüdischen Auswanderungsbewegung und Mitglied der Helsinki-Gruppe galt ausschließlich dem Ziel, die internationale Öffentlichkeit und die entsprechenden sowjetischen Organisationen über grobe Rechtsverletzungen seitens der sowjetischen Behörden hinsichtlich der Rechte von Bürgern, die die UdSSR verlassen wollten, zu informieren und entsprachen vollkommen…” Schtscharanski antwortete auf die übliche Art und Weise, in der er mit ausländischen Journalisten kommunizierte, was seinen Gesprächspartner natürlich verärgerte.
„Das ist hier keine Pressekonferenz! Und Sie werden auch auf keiner mehr auftreten. Genug der Verleumdung! Es ist Zeit, sich vor dem Volk zu verantworten. Wenn Sie Informationen weitergegeben haben, dann reden Sie – wo, wann und an wen. Sie scheinen sich Ihrer Lage noch nicht bewusst zu sein. Ihnen droht die Todesstrafe. Die Erschießung … Und nur Sie allein können sich retten und nur dann, wenn Sie aufrichtige Reue zeigen. Auf Ihre amerikanischen Freunde können Sie nicht mehr zählen”.
Rede des Untersuchungsrichters aus den Memoiren von Nathan Schtscharanski Ich fürchte kein Unglück.
Die Bezeichnung „Vaterlandsverräter” stammte noch aus der Stalinzeit. In den 1930er Jahren wurden „Volksfeinde” häufig beschuldigt, für ausländische Staaten zu spionieren oder terroristische Organisationen zu gründen. Nach Stalins Tod hätte diese Praxis eigentlich der Vergangenheit angehören sollen, doch als die neuen Machthaber ihren ehemaligen Mitstreiter Lawrenti Berija verhafteten, wurde er des Vaterlandsverrats und der Spionage für Großbritannien beschuldigt. Nach und nach festigte sich die Vorstellung, dass jeder Regimegegner automatisch ein Verräter war.
Für die „Vaterlandsverräter“ gab es eine Vielzahl offizieller und inoffizieller Bezeichnungen. Solshenizyn nannte man einen „Abweichler“ und „literarischen Wlassowez “. Als Andrei Sacharow den Kongress der USA dazu aufforderte, die Jackson-Vanik Änderung zu verabschieden, die die UdSSR verpflichtete, im Tausch gegen Handelsvorteile die jüdische Auswanderung zu erlauben, erklärte die sowjetische Presse sein Verhalten für „antipatriotisch“ und sowjetische Akademiker beschuldigten ihn in einem offenen Brief, „faktisch zur Waffe der feindlichen Propaganda gegen die Sowjetunion“ geworden zu sein.
Diese Anschuldigungen entbehrten nicht einer gewissen Grundlage: In ihrem Kampf für Freiheit und Menschenrechte stützten sich die Dissidenten tatsächlich auf Medien und Verlage aus dem Westen und der Emigration. Sie waren auf die Hilfe von Korrespondenten aus dem Westen und manchmal auch von Botschaftsmitarbeitern oder Diplomaten angewiesen, um ihre Artikel und Manuskripte ins Ausland zu übermitteln. Aus der engen Kommunikation erwuchs nicht selten eine Freundschaft. Die westlichen Journalisten erhielten von den Dissidenten Informationen zur politischen und gesellschaftlichen Situation im Land, zu nationalen und religiösen Bewegungen. Im Gegenzug nahmen sie an Pressekonferenzen teil, die von prominenten Dissidenten organisiert wurden, was deren Forderungen danach, politische Gefangene freizulassen und die Menschenrechte einzuhalten, internationale Resonanz verlieh.
Diese Situation war durchaus paradox: Einerseits war ein Dissident für den KGB möglicherweise überhaupt nicht interessant, solange er keinen Kontakt zum Westen herstellte, nicht versuchte, seine Texte zu veröffentlichen und man nicht auf Radio Swoboda (Radio Liberty) oder in anderen westlichen Medien von ihm sprach. Andererseits waren es gerade die westliche öffentliche Meinung, die Proteste westlicher Wissenschaftler und Schriftsteller, westliche Nichtregierungsorganisationen und einzelne Politiker, die die Dissidenten vor Repressionen schützten.
1978 verweigerte Nathan Schtscharanski vor Gericht ein Geständnis und wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Seine „westlichen Freunde“ starteten jedoch – trotz der Drohungen des Ermittlers – eine massive Kampagne zu seiner Unterstützung. Am 11. Februar 1986 wurde er in Berlin auf der berühmten Glienicker „Agentenbrücke“ zusammen mit zwei Ostdeutschen und einem Tschechoslowaken gegen drei im Westen verhaftete osteuropäische Agenten ausgetauscht.
Für Schtscharanski begann in Israel ein neues Leben. Zur Zeit seiner Ausreise befanden sich die meisten, die der sowjetischen Dissidentenbewegung zugerechnet wurden, bereits im Westen. Aber nicht alle lebten so unbeschwert, wie sie es sich erhofft hatten.
Foto © National Conference on Soviet Jewry
8. Emigration
Am 15. Juni 1970 begaben sich mehrere Personen auf das Rollfeld eines kleinen Flugplatzes in der Oblast Leningrad, darunter auch Eduard Kusnezow, ein ehemaliger politischer Gefangener und Jude, der wie viele andere erfolglos versucht hatte, nach Israel auszuwandern. Man hatte ihnen mehrfach das Visum verweigert und im Laufe eines Jahres heckten sie einen detaillierten Plan aus, der später den Decknamen „Operation Hochzeit“ erhielt: Sie täuschten vor, einer Hochzeit beiwohnen zu wollen, und planten ein Flugzeug zu kapern, damit über die sowjetisch-finnische Grenze zu fliegen und später in Schweden zu landen. Dort wollten sie eine Pressekonferenz zur Rechtslage der sowjetischen Juden abhalten.
„Operation Hochzeit“
Doch der KGB bekam von ihren Plänen Wind. Ein Teil der Verschwörer wurde an der Gangway des Flugzeugs festgenommen, ein anderer auf dem Flughafen von Priosersk, wo die Maschine zwischenlanden sollte. Sechs Monate später wurden Eduard Kusnezow und die anderen Teilnehmer der gescheiterten Mission vor Gericht gestellt. Sie wurden wegen Vaterlandsverrats, versuchtem schweren Diebstahl und antisowjetischer Agitation angklagt. Die beiden Hauptverantwortlichen – Eduard Kusnezow und Mark Dymschtschiz – wurden zum Tode verurteilt, die übrigen Teilnehmer erhielten Haftstrafen zwischen 4 und 15 Jahren.
Nach massiven Protesten im Westen und dank der direkten Intervention des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon und Israels Ministerpräsidentin Golda Meir wurde die Todesstrafe für Kusnezow und Dymschitz in 15 Jahre Lagerhaft umgewandelt. 1979 wurde Kusnezow zusammen mit anderen Dissidenten gegen zwei sowjetische Spione ausgetauscht und reiste in der Folge mit seiner Frau nach Israel aus.
Der Flugzeug-Fall wurde zum Sinnbild dafür, wie groß der Wunsch vieler sowjetischer Juden war, die Sowjetunion, in der sie regelmäßig mit Antisemitismus konfrontiert waren, um jeden Preis zu verlassen. Dank der Abschwächung der internationalen Spannungen in den 1970er Jahren erhielten immer mehr Sowjetbürger die Möglichkeit, das Land zu verlassen, insbesondere Juden und Deutsche. Die Emigration als solche war nicht einfach, nicht nur wegen der vielen Beschränkungen seitens der Behörden. Auswanderungswillige waren bei der Arbeit häufig öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Viele wurden entlassen, sobald sie ein Ausreisevisum beantragt hatten, auch wenn dieses noch nicht bewilligt worden war. Diejenigen, die eine Ausreisegenehmigung erhielten, verließen das Land ohne jede Hoffnung auf Rückkehr. Bei der Ankunft in Europa entschieden sich viele nicht für Israel als neues Heimatland, sondern für Frankreich, Deutschland oder die USA, wo sie politisches Asyl erhielten und versuchten, sich ein neues Leben aufzubauen.
„Nicht-Rückkehrer“
Aber sogar dieser beschwerliche Weg blieb denjenigen verwehrt, die keine jüdischen Wurzeln oder Verwandte in Israel oder Westdeutschland nachweisen konnten. Selbst kurzzeitige Reisen ins Ausland – um an wissenschaftlichen Konferenzen teilzunehmen oder auf Tournee zu gehen – waren seltene Privilegien. Die sowjetischen Behörden prüften jeden, den sie hinter den eisernen Vorhang ließen, sorgfältig auf seine Loyalität. Trotzdem kam es immer wieder vor, dass Sowjetbürger der Beobachtung durch die KGB-Mitarbeiter entkamen, die speziell auf die sowjetischen Delegationen abgestellt waren und im Westen Asyl beantragten. Diese Leute wurden als „Nicht-Rückkehrer“ bezeichnet. Zu den berühmtesten zählen der Ballett-Tänzer Michail Baryschnikow, der Regisseur Andrej Tarkowski und Stalins Tochter Swetlana Allilujewa.
Doch selbst für diejenigen Dissidenten, die davon geträumt hatten, der UdSSR zu entkommen, erwies sich das Leben im Westen oftmals als schwierig und nicht immer so, wie sie es sich aus der Sowjetunion heraus vorgestellt hatten. Nur wenigen gelang es, sich voll und ganz an das Leben im Westen anzupassen, das auf den Prinzipien der freien Marktwirtschaft basierte und wo der Staat die schöpferischen Berufe nicht unterstützte und jeder für sein eigenes Stückchen Brot kämpfen musste. Für einen Emigranten, der die Sprache des neuen Landes nicht beherrschte, war es äußerst schwer, eine Stelle in seinem Beruf zu finden. Am einfachsten war es noch für Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler. Deutlich schwieriger war es für Geisteswissenschaftler. Für viele Dissidenten bedeutete die Emigration das Ende ihrer ursprünglichen beruflichen Laufbahn und ein Leben in Armut.
Gegenseitige Enttäuschung
Manchem gelang es, eine Stelle bei Radio Liberty oder bei einer der Emigrantenzeitungen und -journale zu finden. Einige wurden Berufs-Dissidenten, die man als Experten für die Sowjetmacht heranzog und deren Expertise man im Westen in den 1970er Jahren schätzte. Das Interesse an der Sowjetunion und den Dissidenten ging jedoch mit der Zeit zurück: Nachdem Shores Medewedew 1973 zur Ausreise gezwungen worden war, nahm er regelmäßig an Konferenzen in den USA teil und hielt oft Vorträge über das Dissidententum. Ende 1976 riet ihm jedoch der Politikwissenschaftler Rudolf Tokes, der ihn zu einem Vortrag eingeladen hatte, sich auf andere Themen zu konzentrieren, weil das Thema nicht mehr aktuell sei.
Die Begegnung zwischen den sowjetischen Dissidenten und dem Westen war wie das Zusammentreffen zweier Menschen, die sich aus der Ferne ineinander verliebt und ein imaginäres Bild voneinander gemacht hatten. Als sie sich endlich gegenüberstanden, kam es unweigerlich zu einer gegenseitigen Enttäuschung. Interessanterweise waren die sowjetischen Emigranten gerade von den Aspekten der westlichen Realität schockiert, die die sowjetische Propaganda so gerne in allen Farben ausmalte. Nur dass sie die Schreckensgeschichten über den Kapitalismus erst dann ernstnahmen, als sie die soziale Ungerechtigkeit und die westliche „Herrschaft des Geldes“ am eigenen Leibe zu spüren bekamen. Umso schmerzhafter war es, dass sie in der Emigration in der Regel ihren Status als kreative oder intellektuelle Elite verloren, den sie in der sowjetischen Gesellschaft immerhin zu einem gewissen Grade besessen hatten. Insofern überrascht es nicht, dass manche der sowjetischen Dissidenten mit Kritik über den Westen herfielen, der ihnen Zuflucht gewährte, und damit in der westlichen Öffentlichkeit wiederum auf Unverständnis stießen.
Foto: 1963 in Mordowien © Archiv FSO
9. Die Heroisierung der Dissidenten
Am 8. Juni 1978 war Alexander Solshenizyn zu einem Vortrag vor Harvard-Studierenden eingeladen. Man erwartete von dem Schriftsteller, der mit der Publikation des Archipel Gulag weltweite Bekanntheit erlangt hatte, dass er auch bei dieser Veranstaltung das blutige Regime von Breshnew und Stalin anprangern würde. Doch in der Rede, die später den Titel Die gespaltene Welt erhielt, galt Solshenizyns Kritik nicht der Sowjetunion, sondern dem Westen. „Die Wahrheit schmeckt selten süß, fast immer ist sie bitter“, warnte der Schriftsteller gleich zu Beginn in prophetischem Tonfall. Nach seiner Auffassung irrte der Westen, indem er versuchte, anderen Ländern sein System der Demokratisierung überzustülpen. Die westliche Gesellschaft leide selbst an zahlreichen Übeln: dem Niedergang der Zivilcourage, einer fehlenden Opferbereitschaft, einer zerstörerischen, verantwortungslosen Freiheit, unter anderem jener der „freien“ Presse, die finanziellen Interessen und dem Diktat der Mode unterworfen sei. Selbstverständlich lag es Solshenizyn fern, den Sozialismus über den Kapitalismus zu stellen. Dennoch schloss er mit den Worten:
„… sollte jemand mich fragen, ob ich den Westen, so wie er heute ist, meinem Land als Modell ans Herz legen wollte, würde ich offen gesagt mit Nein antworten müssen. Nein, ich könnte eure Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Form nicht als Ideal für die Veränderung meiner Gesellschaft empfehlen. Durch tiefes Leiden hat unser Land nun eine geistige Entwicklung von solcher Intensität erreicht, dass das westliche System in seinem gegenwärtigen Zustand geistiger Erschöpfung nicht attraktiv erscheint.”
Aus der Harvard-Rede von Alexander Solschenizyn, 1978
Solshenizyns geistig-moralische Kritik musste im Westen auf Befremden und Unverständnis stoßen. Viele erkannten die Tiefgründigkeit seiner Rede an, glaubten jedoch, dass seine Vorstellungen vom Westen falsch seien und auf einer oberflächlichen Kenntnis der westlichen Verhältnisse beruhten. So mancher empfand seine Rede sogar als undankbar. Vielen war schlichtweg nicht klar, dass ein Dissident immer Dissident bleibt, egal, wo er sich befindet.
Moralische Avantgarde einer stillen Masse?
Solshenizyns Enttäuschung von der westlichen Gesellschaft war genauso groß wie seine Idealisierung derselben einige Jahre zuvor. Die Vorstellung, die sich im Westen über sowjetische Dissidenten herausgebildet hatte, entpuppte sich als ausgesprochen oberflächlich. Dissidenten wurden in erster Linie als Helden wahrgenommen, was in Anbetracht des ideologischen Konflikts zwischen Ost und West naheliegend war. In den 1970er Jahren wurden gleich zwei sowjetische Dissidenten mit dem Nobelpreis ausgezeichnet: Solshenizyn bekam 1970 den Nobelpreis für Literatur und Andrej Sacharow 1975 den Friedensnobelpreis. Wie sollten die Menschen im Westen auch nicht beeindruckt sein von dem Mut, offen gegen ein autoritäres Regime aufzutreten, wohl wissend, dass einem dafür viele Jahre Gefängnis drohten? Wie sollten sie in den politischen Gefangenen keine Märtyrer für die Menschenrechte sehen? Zu groß war die Versuchung, diese mutigen Kämpfer zur moralischen Avantgarde einer kritischen, aber stillen Masse zu erklären, gerade weil die Dissidenten sich auf die für den Westen so zentralen Themen beriefen: Menschenrechte und Achtung des Gesetzes.
Doch am Ende waren unter den sowjetischen Dissidenten einige, die keineswegs den westlichen Vorstellungen von Anhängern demokratischer Prinzipien entsprachen. In den Reihen der Regimegegner waren Monarchisten, die wie Solshenizyn eine gemäßigte autoritäre Regierung mit traditionalistischen Tendenzen anstrebten, und auch Nationalisten, die weniger gegen den Kommunismus kämpften als gegen die imperiale Unterdrückung durch die Sowjetmacht. Wobei sie sich in ihren eigenen Republiken überhaupt nicht um die Rechte ethnischer Minderheiten kümmerten.
Der georgische Dissident Swiad Gamsachurdia, der gute Beziehungen nach Moskau hatte, war Mitbegründer der Initiativgruppe für die Verteidigung der Menschenrechte in Georgien und Mitglied der sowjetischen Sektion von Amnesty International. 1977 war er Mitbegründer der georgischen Helsinki-Gruppe, weswegen er für zwei Jahre nach Dagestan verbannt wurde. Zwei Jahre später wurde er von amerikanischen Kongressabgeordneten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Nur wenige Jahre später führte Gamsachurdia die Unabhängigkeitsbewegung in Georgien an und wurde 1990 schließlich zum Präsidenten des Obersten Sowjets der Georgischen SSR gewählt. Als im November 1989 die Bewohner Südossetiens eine unabhängige Republik innerhalb der Georgischen SSR ausriefen, organisierte Gamsachurdia den Sturm auf Zchinwali; 50.000 seiner Anhänger veranstalteten eine Blockade der Stadt, im Zuge derer Dutzende Osseten getötet und Hunderte verletzt wurden. Ebenso wurden unter seiner Herrschaft Aserbaidshaner diskriminiert, und es wurde ein Erlass zur gewaltsamen Verfolgung ethnischer Minderheiten verabschiedet. Gamsachurdia wurde im Januar 1992 durch einen Militärputsch gestürzt.
Das Beispiel Gamsachurdias warf in der westlichen Gesellschaft und unter Politikern die Frage auf, ob man alle Proteste gegen die Verletzung von Menschenrechten unterstützen sollte, unabhängig von den politischen Überzeugungen und den Mitteln der Protestierenden. Diese Frage hat bis heute nicht an Aktualität verloren. Als die französische Regierung dem politischen Aktivisten und Aktionskünstler Pjotr Pawlenski politisches Asyl gewährte, hatte sie wohl kaum damit gerechnet, dass er sein Publikum auch in der neuen Heimat mit politischen Performances schockieren würde. Nach dem Anzünden der FSB-Tür in Moskau kam Pawlenski mit einer Geldstrafe davon, aber als er eine ähnliche Aktion an den Fenstern Banque de France wiederholte, wurde er sofort festgenommen und zu einem Jahr Haft und zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.
Dissidenten und Andersdenkende sind per Definition Menschen, deren Überzeugungen den Überzeugungen und Werten der Gesellschaft entgegenstehen. Sie bilden eine Minderheit und sind nur in seltenen Fällen, wie z. B. im Fall von Andrej Sacharow mit einer breiten Anhängerschaft, Sprachrohre einer eingeschüchterten Masse. Von den „gehorsamen Bürgern“ unterscheidet sie nicht nur ihr großer Mut und ihre moralische Haltung, sondern oft auch, wie im Fall von Alexander Solzhnizyn, eine recht spezielle Vorstellung von der Zukunft des Landes, die nicht immer mit den westlichen Werten von Freiheit und Demokratie vereinbar ist.
Foto: Harvard-Rede, 1978 © Getty Images/Bettmann
10. Freiheit und der Zerfall der UdSSR
Am späten Abend des 15. Dezember 1986 schrillte in der Wohnung in Gorki (heute: Nishni Nowgorod), in der Andrej Sacharow mit seiner Frau seit sieben Jahren in Verbannung lebte, plötzlich die Türklingel. Zwei Elektriker in Begleitung eines KGB-Mitarbeiters traten ein. Sie stellten die Telefonleitung wieder her und sagten, Sacharow würde morgen um 10 Uhr einen Anruf erhalten. Um drei Uhr nachmittags läutete endlich das neue Telefon. Am anderen Ende war Michail Gorbatschow . Der Generalsekretär der KPdSU verkündete dem berühmten Dissidenten in freundschaftlichem Ton, dass seine Verbannung vorbei sei und er jetzt „zu patriotischen Taten“ zurückkehren könne.
Perestroika und Glasnost
Ein paar Monate später wurde auf der Welle der Perestroika der Großteil der politischen Häftlinge aus den sowjetischen Lagern befreit, viele von ihnen nahmen ihre politischen und gesellschaftlichen Tätigkeiten wieder auf.
Die ehemaligen Gewissensgefangenen kehrten in eine komplett neue Gesellschaft zurück, in der Meinungsfreiheit und Demokratie keine leeren Worte mehr waren. Unzählige informelle politische und soziale Klubs entstanden, Amateurzeitungen wurden privat gedruckt, niemand wurde deswegen verfolgt. Dank der Politik derGlasnost konnten literarische Werke und Filme zu bisher tabuisierten Themen publiziert werden, vor allem über die Repressionen der Stalinzeit.
1988 kehrte Roi Medwedew ins öffentliche Leben des Landes zurück, in den sowjetischen Zeitschriften erschienen nach und nach seine Texte über den Stalinismus. Der Name Solshenizyn war lange verboten gewesen, doch im Sommer 1989 erwirkte die sowjetische Intelligenzija auch eine Veröffentlichung von Archipel Gulag.
Viele unfreiwillige Emigranten hatten nun die Möglichkeit, in die UdSSR zurückzukehren. 1989 reiste nach 16 Jahren Emigration Shores Medwedew wieder ein, der im Juni 1990 per Sondererlass die sowjetische Staatsbürgerschaft zurückerhielt. Die Liste der Zurückkehrenden wurde immer länger, und bald schien auch Regimefeind Nr. 1 darin auf, Alexander Solshenizyn. Ljudmila Alexejewa, die 1977 wegen drohender Verhaftung nach Amerika ausgewandert war, kehrte 1993 nach Russland zurück und wurde Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe. Die meisten Emigranten jedoch, Gorbanewskaja, Bukowski oder Kusnezow etwa, blieben im Westen. Vielen ehemaligen Otkasniks fanden nun ihre Identität in Israel. Natan Schtscharanski etwa durchlief eine erfolgreiche politische Karriere und leitete fast zehn Jahre lang verschiedene israelische Ministerien.
Ausgeblutete Dissidentenbewegung
Das Sowjetregime, das über 70 Jahre bestanden hatte, bekam in den 1980er Jahren Risse und erlitt Ende 1991 den endgültigen Zusammenbruch . Die Gründe dafür waren zahlreich: von wirtschaftlichen Problemen bis zu Fragen der Weltpolitik. Doch im Unterschied zu anderen sozialistischen Staaten wie Tschechien, dessen Präsident der bekannte Dissident Václav Havel wurde, spielten die Dissidenten der UdSSR in diesem Prozess keine entscheidende Rolle. Die Verfolgungen der 1970er und 1980er Jahre hatten die Dissidentenbewegung ausgeblutet, sodass weder Solshenizyn noch Sacharow an die Macht kommen konnten.
Sacharow nahm in seinem letzten Lebensjahr aktiv an Russlands politischem Leben teil: Im Frühling 1989 wurden er und Roi Medwedew bei den ersten relativ freien Wahlen als Abgeordnete zum Volksdeputiertenkongress gewählt. Bei Weitem nicht alle ehemaligen politischen Häftlinge akzeptierten diesen Schritt: Für viele kam eine Beteiligung an Strukturen, die die Sowjetmacht geschaffen hatte, auf keinen Fall in Frage. Sacharow und Medwedew hingegen schien die Demokratisierung des Regimes neue Möglichkeiten zur Umsetzung jener Veränderungen eröffnen, für die sie schon lange gekämpft hatten.
Nach sieben Jahrzehnten Autoritarismus klebte das ganze Land an den Fernsehbildschirmen und diskutierte lebhaft die Reden der Deputierten am Ersten Kongress im Mai/Juni 1989. Während Medwedew aktiv Gorbatschow unterstützte und als Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU politische Karriere machte, behielt Sacharow seine Funktion als „Volksgewissen“ und forderte von Gorbatschow mehr Mut bei der Durchführung seiner Reformen. Solshenizyn schloss sich der öffentlichen Diskussion an, indem er 1990 seinen Essay Kak nam obustroit Rossiju (dt. Russlands Weg aus der Krise) veröffentlichte. 1994 kehrte er nach Russland zurück, doch trotz des überschwänglichen Empfangs fand er, dass seine Stimme nicht gehört würde. Im postsowjetischen Russland spielte er im öffentlichen Diskurs eine eher marginale Rolle.
Alexander Ogorodnikow kam 1987 frei, versuchte sich ebenfalls in der Politik und gründete die Christlich-Demokratische Partei. Seine Versuche, sich als Abgeordneter wählen zu lassen, blieben jedoch erfolglos.
Memorial
Spürbarer war die Rolle der Dissidenten bei gesellschaftlichen Veränderungen, bei der Errichtung einer Zivilgesellschaft, die für die Konsolidierung der demokratischen Umgestaltungen notwendig war. In erster Linie betraf das das Gedenken der Opfer politischer Repressionen und die Aufarbeitung staatlicher Verbrechen, die nicht wiederholt werden durften.
Im Oktober 1988 wurde eine Woche des Gewissens abgehalten, während derer in Moskau eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema stalinistische Repressionen stattfand. In einem Moskauer Kulturhaus wurden Entwürfe zu einem Denkmal für die Opfer politischer Verfolgung ausgestellt, das schon Chruschtschow versprochen hatte bauen zu lassen. Die Errichtung eines solchen Denkmals war eine der Forderungen einer Gruppe, in der sich Mitglieder mehrerer informeller Klubs zusammengefunden hatten: Diese Gemeinschaft bekam den NamenMemorial . Ein Anführer dieser Bewegung war Arseni Roginski, der 1985 aus dem Lager entlassen wurde. Im ganzen Land entstanden regionale Gruppierungen, die sich der Initiative von Memorial anschlossen. Was als Unterschriftensammlung für eine Petition begonnen hatte, wurde nach und nach zu einem ambitionierteren Projekt: Memorial sollte eine gesamtsowjetische Organisation werden, die sich auf regionaler Ebene um das Gedenken der Opfer des stalinistischen Terrors kümmert und die Geschichte dieser Zeit erforscht. Geplant war die Eröffnung eines öffentlich zugänglichen Forschungs- und Aufklärungszentrums mit einer Bibliothek, einem Museum und einem Archiv.
Allerdings sollte Memorial politisch unabhängig bleiben, und das machte seine offizielle Anerkennung schwierig. Im Juni 1988 organisierten Memorial-Aktivisten zwei öffentliche Kundgebungen und übergaben der Parteikonferenz tausende Unterschriften. Die Regierung stimmte der Errichtung eines Denkmals zu, doch Memorial musste noch lange um die offizielle Registrierung kämpfen. Im Sommer 1988 wurde auf Basis von Straßenumfragen Andrej Sacharow zusammen mit Solshenizyn, Roi Medwedew und anderen prominenten Persönlichkeiten in den Vorstand von Memorial gewählt. Während Solshenizyn diesen Posten ablehnte, beteiligte sich Sacharow aktiv an der Errichtung der Organisation und willigte ein, ihr vorzusitzen. Im Januar 1989 wurde die Gründungskonferenz des noch immer nicht registrierten Vereins einberufen. Die Staatsmacht traute einer unabhängigen gesellschaftlichen Initiative nach wie vor nicht über den Weg.
Andrej Sacharow starb plötzlich mitten in all diesen Transformationen – am 14. Dezember 1989. Schon zu Lebzeiten war er zu einer Ikone der Menschenrechtsbewegung geworden, und als solche verblieb er auch im kollektiven Gedächtnis – tausende Menschen begleiteten ihn auf seinem letzten Weg. Als bei der Beerdigung Gorbatschow auf Sacharows Witwe Jelena Bonner zutrat und sie fragte, was er zur Verewigung seines Gedenkens tun könne, sagte sie: „Da brauche ich nicht lang nachzudenken! Sorgen Sie für eine Registrierung von Memorial – damit ist seiner gedacht.“
Anfang 1990 wurde die gesamtsowjetische Organisation Memorial offiziell registriert, und am 30. Oktober 1990 wurde auf dem Lubjanka-Platz ein Denkmal für die Opfer politischer Repressionen enthüllt, direkt vor dem Gebäude des KGB. Ein einfacher Felsblock von den Solowezki-Inseln , wo in den 1920er und 1930er Jahren das erste sowjetische Arbeitslager errichtet worden war.
Zerfall des Imperiums
Zur selben Zeit nahmen in der ganzen Sowjetunion Nationalbewegungen Schwung auf, die über siebzig Jahre von der Sowjetmacht unterdrückt worden waren. Zig- und hunderttausende Menschen nahmen in den Sowjetrepubliken an Demonstrationen teil. Diese Bewegung mit Gewalt niederzuringen, wäre, ohne vom neuen demokratischen Kurs abzuweichen, unmöglich gewesen. Dort, wo es trotzdem gewaltsame Zusammenstöße gab, wie in Litauen oder Georgien, verstärkte das die Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Republiken erst recht. Höhepunkt des friedlichen Volksaufstands war wohl der Baltische Weg : Zum 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts , der 1939 zur Annexion von Estland, Lettland und Litauen durch die Sowjetunion geführt hatte, bildeten zwei Millionen Bewohner der baltischen Republiken zwischen Tallinn und Vilnius eine 670 km lange Menschenkette.
Am 26. Dezember 1991 hörte die Sowjetunion zu existieren auf. Auf dem Gebiet des ehemaligen Imperiums begann eine neue Geschichte, doch die demokratischen Bestrebungen der vergangenen Jahre schlugen bei Weitem nicht überall Wurzeln. Radikale Wirtschaftsreformen hatten die russische Bevölkerung bis an die Armutsgrenze getrieben und mit dieser traumatischen Erfahrung den Worten „Freiheit“ und „Demokratie “ einen bitteren Beigeschmack verliehen. Dreißig Jahre später herrscht in Russland wieder eine eiserne Hand, unter anderer Flagge zwar, aber genauso brutal.
Sacharow nahm in seinem letzten Lebensjahr aktiv an Russlands politischem Leben teil. Sacharow behielt seine Funktion als „Volksgewissen“ und forderte von Gorbatschow mehr Mut bei der Durchführung seiner Reformen / Foto: Sacharow und Gorbatschow, 9. Juni 1989 / Foto © Boris Babanow, RIA Nowosti Im Frühling 1989 wurde Roi Medwedew bei den ersten relativ freien Wahlen als Abgeordneter zum Volksdeputiertenkongress gewählt. Sein Bruder Shores konnte 1989 nach 16 Jahren im Exil wieder einreisen / Foto: Shores und Roi Medewedew, 1995 © Margarita Medwedewa Viele unfreiwillige Emigranten hatten nun die Möglichkeit, in die UdSSR zurückzukehren. 1994 kam auch Regimefeind Nr. 1 Alexander Solshenizyn in das Land zurück. Trotz des überschwänglichen Empfangs fand er, dass seine Stimme nicht gehört würde. Foto: Solshenizyn am Flughafen Magadan 27. Mai 1994 © D. Korotajew, RIA Nowosti Ljudmila Alexejewa, die 1977 wegen drohender Verhaftung nach Amerika ausgewandert war, kehrte 1993 nach Russland zurück und wurde Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe / Foto © Sergej Gunejew, RIA Nowosti Nach dem Zerfall der UdSSR blieben die meisten Emigranten, darunter auch Natalja Gorbanewskaja, im Westen / Foto: Festempfang der Teilnehmer der Demonstration von 1968 im Prager Rathaus. In der Mitte – Gorbanewskaja / Foto © Archiv FSO Natan Schtscharanski durchlief eine erfolgreiche politische Karriere und leitete fast zehn Jahre lang verschiedene israelische Ministerien / Foto: Treffen von Natan Schtscharanski mit Wladimir Putin 2000 © kremlin.ru CC BY 4.0 1985 wurde Arseni Roginski aus dem Lager entlassen. Er wurde einer der Gründer von Memorial, der Organisation, der er ab 1998 bis zu seinem Tod 2017 vorstand / Foto © A. Sawin, Wikisklad unter CC BY-SA 3.0
Das Land, in das Marija Aljochina und Nadeshda Tolokonnikowa im Herbst 2013 aus dem Frauenstraflager zurückgekehrt sind, war nicht mehr das alte. Und es sollte sich im Zuge von wenigen Jahren noch stärker verändern. Politische Häftlinge, „ausländische Agenten“, Verfolgung politischer Opponenten, allmähliches Verbot von Protestaktionen, stetig wachsende Rolle der Geheimdienste und außenpolitische Aggression. Das alles bestimmt heute die russische Wirklichkeit, die immer mehr an die vergangen geglaubte Sowjetunion erinnert.
Gibt es im neuen Russland Platz für Dissens? Hat es heute Sinn, die Erfahrungen der sowjetischen Dissidenten zu erforschen? Die Antworten auf diese Fragen liegen auf der Hand. Dissidenten leben uns vor, dass ein Mensch in jeder Situation die Macht hat, er selbst zu bleiben und seinem Gewissen zu folgen, egal welchen Preis er für seine innere Freiheit zahlen muss.
zitiert nach: Solshenizyn, Alexander (1974): Lebt nicht mit der Lüge, in: Solshenizyn, Alexander: Offener Brief an die sowjetische Führung, übersetzt von Wolfgang Kasack, Darmstadt
Übersetzung aus dem Russischen: Ruth Altenhofer, Anselm Bühling, Maria Rajer, Henriette Reisner, Hartmut Schröder und Jennie Seit
Übersetzungsredaktion: Friederike Meltendorf
Veröffentlicht: 10. Juni 2022